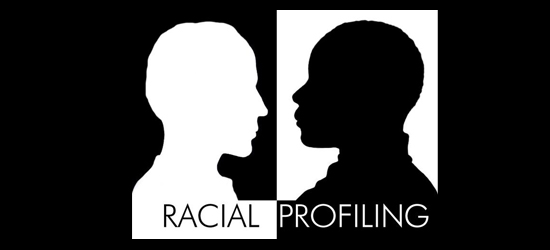Racial Profiling und polizeiliche Kontrollen
Ein Kastenwagen hält, Polizisten stürmen heraus und bauen sich vor den Jugendlichen auf. Personenkontrolle: Alle Gegenstände aus den Taschen nehmen und auf den Boden ausleeren. Ausweise vorzeigen, sich durchsuchen lassen und gegebenenfalls auch die Hose öffnen, damit die Polizisten den «Genitalbereich» inspizieren. Bedran (17) und Gabar (18) kennen das zur Genüge. An manchen Tagen werden sie drei oder vier Mal kontrolliert - auf dem Heimweg von der Schule, beim Herumhängen im Park oder vor der eigenen Haustür, was ihnen wegen der zuschauenden NachbarInnen besonders peinlich ist. Es trifft sie regelmäßig, weil sie nicht so aussehen, wie man sich «normale Schweizer» vorstellt. Sie wohnen im Zürcher Langstrassenquartier: Hier gab es die offene Drogenszene, hier gibt es Prostitution, aber auch mehr und mehr schicke Clubs und Restaurants; hier wohnen (noch) viele ImmigrantInnen, so lange sie sich die steigenden Mieten leisten können.
Für das, was Bedran und Gabar an einer Veranstaltung im November 2013 in ihrem Jugendzentrum schilderten, gibt es einen Begriff: Von «Racial Profiling» ist die Rede, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres «fremden» Aussehens oder ihrer (vermuteten) Herkunft eine besondere Gefährlichkeit zugeschrieben wird oder/und sie zum Objekt polizeilicher Massnahmen werden. Es geht also um eine rassistische Diskriminierung – und zwar um eine, die nötigenfalls auch mit staatlicher Gewalt durchgesetzt wird. «Racial Profiling» ist seit einigen Jahren quer durch Europa zum Thema geworden (siehe Kasten). Im Vordergrund der Debatte stehen dabei Kontrollen von Polizei und Grenzschutzdiensten. Das gezielte Herauspicken von ImmigrantInnen und Angehörigen ethnischer Minderheiten wird dabei dadurch begünstigt, dass Kontrollen als harmlose Grundrechtseingriffe gelten, die rechtlichen Voraussetzungen daher nur gering sind und die RepräsentantInnen der staatlichen Gewalt sich kaum rechtfertigen müssen.
Grenzkontrolle im Landesinnern
Das gilt auch für die Schweiz: Klar und deutlich ist dies bei den Kontrollen, die das Grenzwachtkorps (GWK) im Landesinneren durchführt. Mit dem Schengen-Beitritt 2008 führte die Schweiz «nationale Ersatzmassnahmen» für den Abbau der Schengener Binnengrenzen ein: Die Aktivitäten des GWK wurden zu einen grossen Teil ins Landesinnere verlegt. Wie in Deutschland war nun auch in der Schweiz von «Schleierfahndung» und von «anlass-unabhängigen Personenkontrollen» die Rede. Das GWK schloss dazu Vereinbarungen mit den Kantonspolizeien. Es kontrolliert seitdem nicht nur im grenznahen Gebiet, sondern auch im «internationalen Zugverkehr» auf der Nord-Süd- und der West-Ost-Achse. Letzteres bezieht sich nicht nur auf Züge, die tatsächlich über die Grenze fahren, sondern auch auf solche, die nur eine Anbindung an grenzüberschreitende Züge ermöglichen.
Da das Ziel dieser ins Inland verlagerten Grenzkontrollen insbesondere darin besteht, nach «illegal» eingereisten und «illegal» sich in der Schweiz aufhaltenden Personen zu suchen, nehmen die GrenzwächterInnen vorwiegend «ausländisch aussehende» Menschen ins Visier. Der Charakter der Kontrolle führt also fast automatisch zu einer rassistischen Selektion der zu Kontrollierenden.
Im Alltag der Städte
Ähnliches gilt für die Kontrollen der Kantons- und Stadtpolizeien. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür sind minimal. Nach dem Zürcher Polizeigesetz beispielsweise darf die Polizei Personen anhalten, ihre Identität feststellen und sie gegebenenfalls auch zu einer Dienststelle bringen, «wenn es zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist.» Zwar hat das Bundesgericht diese Blankovollmacht etwas eingeschränkt: Kontrollen dürften «nicht anlassfrei erfolgen», es seien «objektive Gründe, besondere Umstände, spezielle Verdachtselemente» erforderlich, «etwa eine verworrene Situation, die Anwesenheit in der Nähe eines Tatortes, eine Ähnlichkeit mit einer gesuchten Person, Verdachtselemente hinsichtlich einer Straftat und dergleichen».
Das hört sich zwar gut an, gibt aber leider nicht viel her: Nicht nur in Zürich führt die Polizei in bestimmten, angeblich unruhigen Innenstadtquartieren und Gegenden rund um die Bahnhöfe regelmässige Kontrollen durch. Wo es eine offene Drogenszene oder ein Rotlichtmilieu gibt oder gab, lässt sich die verlangte Nähe zu einem Tatort oder eine sonstige Auffälligkeit pauschal annehmen – auch ohne dass von der kontrollierten Person irgendeine konkrete Gefahr ausgeht.
Auch diese faktisch verdachtsunabhängigen Kontrollen im Alltag der Städte treffen nicht alle gleichermassen: Die Polizei muss eine Auswahl treffen und das tut sie notwendigerweise anhand äusserlicher Merkmalen. Sichtbare Minderheiten, Menschen, die sich durch ihre Hautfarbe, ihren Kleidungsstil oder andere Äusserlichkeiten vom Durchschnitt abheben, geraten häufiger in den zweifelhaften Genuss einer Kontrolle. Dies umso mehr, wenn sie den polizeilichen und politischen Bedrohungsbildern entsprechen. Die Schweiz ist in den vergangenen Jahren aus dem Gerede um angebliche Unsicherheit und zunehmende Kriminalität nicht herausgekommen. Zwei Themen beherrschten die Debatte: die Jugendkriminalität und die Ausländerkriminalität. Hierzu gab es unzählige Berichte – nicht nur in den Boulevardmedien. Parteien von der SVP bis zur SP forderten, die «Ängste der Bevölkerung» ernst zu nehmen und etwas zu tun gegen das Unsicherheitsgefühl. Die Polizei solle mehr Präsenz auf der Strasse zeigen.
Rassismus – auch ohne Rassisten
Für ein «Racial Profiling» braucht es keine rassistische Einstellung bei den kontrollierenden PolizistInnen oder GrenzwächterInnen. Die polizeiliche Alltagserfahrung, die politische Definition von ImmigrantInnen als «gefährlicher» Bevölkerungsgruppe, der Aufenthalt in «gefährlichen» Gegenden oder die Fahrt in «internationalen Zügen» reichen aus, um als gefährlich behandelt zu werden. Für die Betroffenen sind solche Kontrollen erniedrigend, insbesondere wenn sie mit Drohgebärden und körperlichen Durchsuchungen verbunden sind oder sich regelmässig wiederholen. Kontrollen sind eben keine harmlosen, zu vernachlässigenden Eingriffe, bei denen niemand etwas zu befürchten hat, der nichts zu verbergen hat.
Auch ohne rassistische Einstellungen der handelnden PolizistInnen ist das Ergebnis rassistisch. Denn für die Betroffenen lautet der unausgesprochener Begleittext solcher Kontrollen nämlich: «Egal, was in Eurem Pass steht; egal, ob Eure Papiere in Ordnung sind; egal, warum Ihr hier seid und ob Ihr seit Ewigkeiten hier lebt – Ihr seht anders aus, Ihr seid immer verdächtig und eigentlich gehört Ihr nicht hierher»
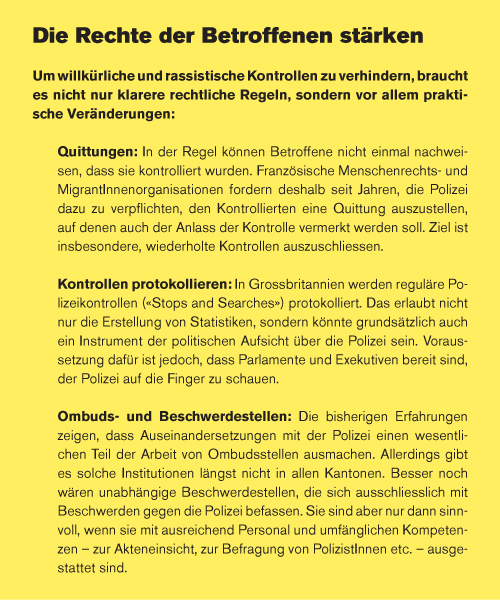
Was tun bei willkürlichen oder rassistischen Polizeikontrollen?
Zwischen Recht und Realität
Viktor Györffy ist Rechtsanwalt in Zürich und Präsident von grundrechte.ch. Wir fragten ihn nach Verhaltenstipps für Betroffene und ZeugInnen.
Die Polizei darf eine Person kontrollieren, «wenn es zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben notwendig ist». Freibriefe wie dieser finden sich nicht nur im Polizeigesetz des Kantons Zürich. Gibt es rechtliche Grenzen für polizeiliche Kontrollen und was taugen diese Grenzen in der Praxis?
Man ist nicht verpflichtet, einen Ausweis mit sich zu tragen. Eine Personenkontrolle muss einen objektiv begründeten Anlass haben. Das kann etwa ein Tatverdacht sein oder die Anwesenheit in der Nähe eines Tatortes. Kontrollen aus vorgeschobenen Gründen, schikanöse Kontrollen oder solche aus reiner Neugier sind unzulässig. Aber: Die Polizei hat die Mittel, um sich vor Ort durchzusetzen, und kann sich sehr kreativ zeigen, wenn es darum geht, die Kontrolle zu rechtfertigen. Es gibt also Mindestvoraussetzungen für eine Kontrolle. Diese sind aber nicht hoch und auch nicht sehr wirksam.
Die Polizei kontrolliert nicht überall in gleichem Masse. Rund um die Bahnhöfe oder in bestimmten Innenstadtvierteln riskiert man eher angehalten zu werden, insbesondere wenn man männlich und jung ist und «ausländisch» aussieht. Wo bleiben da die Grenzen, die das Bundesgericht genannt hat?
In solchen Situationen nützen einem diese Grenzen in der Tat nicht viel. Die Polizei legt ihre Befugnisse sehr weit aus. Einerseits mutieren so in gewissen Gebieten alle, die ein bestimmtes Aussehen haben, zu potenziellen Tätern. An der Zürcher Langstrasse etwa ist der Tatort quasi immer in der Nähe, und die Polizei hat ständig Personen mit bestimmten Profilen im Visier. Andererseits werden Kontrollen auch als Mittel eingesetzt, um die kontrollierte Person einzuschüchtern oder zu vertreiben. In diesen Fällen geht es effektiv gar nicht mehr um die Identität der kontrollierten Person – die vielleicht ohnehin schon bekannt ist – oder um die Verfolgung einer Straftat. In diesen Konstellationen wird die Grenze des Zulässigen immer wieder überschritten, was zumindest in der Gesamtsicht auf die alltägliche Praxis der Polizei deutlich würde. Nur nützt das der betroffenen Person wenig. Sie wird im Einzelfall kaum belegen können, dass der angegebene Grund für die Kontrolle nur vorgeschoben ist.
Wie sollen sich die Leute verhalten, wenn die Polizei sie kontrollieren will? Muss man jede Forderung der Polizei befolgen? Kann man eine illegale Kontrolle verweigern? Wie weit kann man praktisch gehen? Ab wann wird es gefährlich?
Es empfiehlt sich, nach dem Grund der Kontrolle zu fragen, dabei möglichst ruhig und anständig zu bleiben und sich nicht provozieren zu lassen. Klar illegale Kontrollen kann man an sich verweigern. Ob man damit effektiv durchkommt oder zumindest nachträglich rechtlich durchdringt, ist eine andere Frage. Wenn die Polizei die Kontrolle partout durchsetzen will, sitzt man am kürzeren Hebel. Man riskiert, auf den Polizeiposten verbracht zu werden. Die Polizei spult dann oft das volle Programm ab: Durchsuchung, Handschellen, Kastenwagen und Aufenthalt in der Zelle. Man sollte sich also als betroffene Person ob man bereit ist, sich auf eine Auseinandersetzung mit der Polizei einzulassen bzw. bis zu welchem Punkt man dabei gehen will. Dies wird von der Situation und von einem selbst abhängen, aber auch davon, ob es ZeugInnen gibt.
Die Frage, wie weit man gehen kann, stellt sich nicht nur für die Betroffenen einer Kontrolle, sondern auch für ZeugInnen. Was können ZeugInnen tun, wenn sie eine willkürliche Kontrolle beobachten? Ab wann riskieren sie eine Anzeige wegen «Störung einer Amtshandlung» oder ähnlichem?
ZeugInnen dürfen eine Kontrolle aus gebührendem Abstand, ohne die Polizei in ihrer Arbeit zu behindern, beobachten. Die Polizei fühlt sich aber rasch einmal in ihrer Arbeit gestört und versucht, ZeugInnen loszuwerden, indem sie sie wegschickt oder ihrerseits kontrolliert. Das kann dann unter Umständen in eine Anzeige wegen Hinderung einer Amtshandlung münden. Es ist auch zulässig, Bildaufnahmen von einer Kontrolle zu machen, auch, wenn die aufgenommenen Personen auf den Aufnahmen erkennbar sind. Zu beachten sind allerdings die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen. Portraitaufnahmen aus kurzer Distanz sind nicht erlaubt. Die Polizei hat hier immer wieder Mühe mit der Anerkennung der Rechtslage. Also zusammengefasst: Nicht zu nahe rangehen, sich nicht einmischen, aber genau beobachten und danach gegebenenfalls mit dem oder der Betroffenen Kontakt aufnehmen, denn Leute, die die Augen offen halten, sind für die Betroffenen einfach wichtig.
Welche Chancen haben nachträgliche Beschwerden? Was bringt eine Eingabe beim Ombudsman?
Nicht selten enden Auseinandersetzungen darüber, ob die Polizei legal gehandelt hat, in gegenseitigen Strafanzeigen. Die Polizei hat dabei den Vorteil, dass sich die BeamtInnen absprechen können, Rapporte und Wahrnehmungsberichte schreiben und sich so die Beweise im Verfahren selber schaffen. Im Beschwerdeverfahren hat man regelmässig einen schweren Stand, ist aber nicht in jedem Fall chancenlos. Eine Eingabe bei der Ombudsstelle kann die Angelegenheit auf eine ruhigere, sachlichere Ebene führen, die Ombudsstelle kann vermittelnd wirken – so weit es denn eine gibt. Einige Kantone habe noch keine Ombudsstelle. Je nach Polizeicorps kann auch eine Eingabe ans Kommando hilfreich sein. Klar wünschenswert wäre eine mit ausreichenden Mitteln und Kompetenzen ausgestattete unabhängige Beschwerdestelle.
Französische Menschenrechtsorganisationen fordern u.a., dass den Betroffenen bei jeder Kontrolle eine Quittung ausgestellt wird. In Grossbritannien werden „stops and searches“ einschliesslich der Gründe für diese Anhaltungen erfasst. Wie sinnvoll sind solche Forderungen für die Schweiz?
Das wäre sehr zu begrüssen. Je nach Aussehen, Szenezugehörigkeit oder Aufenthaltsort riskiert man, gehäuft kontrolliert zu werden. Mit einer Quittung kann die betroffene Person das wenigstens belegen. Wenn die Gründe für die Kontrolle erfasst werden müssen, so dämpft dies den Eifer der Polizei vielleicht ein wenig. Die Rechtmässigkeit der Kontrolle wird besser überprüfbar. Fälle von 'Racial Profiling', Schikanekontrollen, um eine Szene zu verscheuchen und ähnliche Phänomene lassen sich eher sichtbar machen.
Blick über die Grenzen
In Frankreich
«Police et minorités visibles» ist der Titel einer Studie, die das Centre National de Recherche Scientifiques und die in den USA ansässige «Open Society Justice Initiative» im Jahre 2009 veröffentlichten. Sie wies nach, dass Angehörige «sichtbarer Minderheiten» – also insbesondere Schwarze und Leute aus dem Maghreb, aber auch weisse subkulturell gekleidete Jugendliche – überdurchschnittlich oft kontrolliert werden. Die Studie gab Menschenrechts- und ImmigrantInnenorganisationen erstmals empirisches Material an die Hand und veränderte den öffentlichen Diskurs über die Identitätskontrollen. Zuvor riskierte, wer der Polizei Diskriminierung vorwarf, nicht selten eine Verleumdungsklage. Nun hatte die «Rhetorik des Verleugnens» ausgedient. Im Wahlkampf 2012 unterstützte der Kandidat François Hollande die Forderung, den Kontrollierten jeweils eine Quittung auszustellen. Nach der Wahl wischte der neue Innenminister Manuel Valls dieses Projekt zwar schnell wieder vom Tisch und ein Pariser Gericht wies im Oktober 2013 die Zivilklage von dreizehn willkürlich Kontrollierten ab. Die Debatte über rassistische Kontrollen ist jedoch nicht mehr aus der Welt zu schaffen.
- Die Studie: http://osf.to/1dbkPAk
- Die Kampagne: http://stoplecontoleaufacies.fr
In Grossbritannien
In Grossbritannien gibt es zwar keine Identitätskarten und daher auch keine Identitätskontrollen wie auf dem europäischen Kontinent. Allerdings hat die Polizei die Befugnis, Leute anzuhalten und zu durchsuchen. Im Normalfall braucht sie dafür einen begründeten Verdacht. Das Anti-Terror- und das Gesetz über die öffentliche Ordnung erlaubt ihr aber auch verdachtsunabhängige Anhaltungen und Durchsuchungen. Immerhin werden die «Stop-and-Search»-Aktionen der Polizei protokolliert. Die offiziellen Statistiken des Innenministeriums für Mitte 2010 bis Mitte 2011 zeigen, dass schwarze Menschen siebenmal und AsiatInnen doppelt so häufig betroffen sind als Weisse. Bei den verdachtsunabhängigen Kontrollen ist die «ethnische Unverhältnismässigkeit» noch höher. Aktuelle Berichte zeigen zudem, dass die PolizistInnen in einem Grossteil der Fälle entweder gar keine Angaben machten oder die geforderte Verdachtsschwelle nicht erreicht war. Als Reaktion auf die wachsende Zahl der Stop-and-Search-Fälle und die Pläne der Regierung, die Protokollierungspflicht einzuschränken, entstand 2010 «Stop-Watch», eine Koalition diverser Organisationen und AktivistInnen, die sich gegen das Racial Profiling und für eine faire Polizeiarbeit einsetzen.
- Mehr dazu: www.stop-watch.org.uk
In Deutschland
Im Regionalzug von Kassel nach Frankfurt geriet im Oktober 2010 ein schwarzer deutscher Student in eine Kontrolle der Bundespolizei (ehemals Bundesgrenzschutz). Sein Fall produzierte einiges Aufsehen: Zunächst musste er sich gegen eine Beleidigungsanzeige der kontrollierenden Polizisten wehren. Seine eigene Klage gegen die willkürliche Kontrolle wies das Verwaltungsgericht Koblenz im Februar 2012 in Bausch und Bogen ab. Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz stellte schliesslich fest, dass die Kontrolle diskriminierend und damit rechtswidrig war. Die Bundespolizei entschuldigte sich und der Fall war damit juristisch erledigt. Politisch wehren sich diverse Basisinitiativen gegen die rassistischen Kontrollen der Bundes- und der Landespolizeien. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hielt in einem Gutachten fest, dass die Kontrollbefugnis der Bundespolizei diskriminierend und damit verfassungswidrig ist. Inzwischen sind weitere Klagen hängig.
- Zum Fall: http://bit.ly/1eIIj1n
- Zur Studie des DIM: http://bit.ly/1aDG6ww
- Zur Kampagne: www.stoppt-racial-profiling.de/
Autor: Heiner Busch
- «Immer verdächtig!» ist im Bulletin 01/2014 von Solidarité sans frontières zu finden